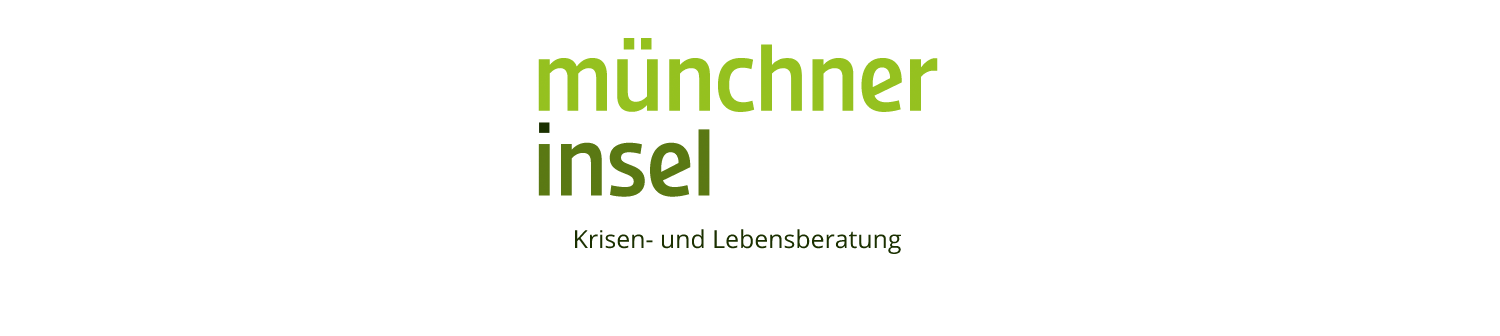Headerlogo auf der Webseite www.seelischegesundheit.net
ABSG-Tagung am 28. April 2025 in Berlin
Am 28. April 2025 von 11:00 bis 16:30 Uhr findet die Jahrestagung des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit (ABSG) statt. Der Veranstaltungsort ist der Deutsche Bauernverband in der Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Best-Practice-Projekten aus dem Netzwerk der 177 Bündnispartner, einer interaktiven Gesprächsrunde zu 50 Jahre Psychiatrie-Enquete und gemeinsamen Arbeitsgruppen. Dabei geht es unter anderem um die Vorbereitung der Woche der Seelischen Gesundheit 2025 zum Thema „Psychisch fit in die Zukunft“. Daneben ist ausreichend Zeit für die persönliche Vernetzung unter den Teilnehmenden eingeplant. Unter https://www.seelischegesundheit.net/neuigkeit/absg-jahrestagung-2025/ steht das gesamte Programm zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die Neuwahl der trialogischen Steuerungsgruppe des Aktionsbündnisses.
Um Anmeldung bis zum 31. März wird gebeten, gerne per E-Mail an koordination@seelischegesundheit.net.
Grafik der Mut-Tour 2025 auf der Seite www.mut-tour.de
MUT-TOUR 2025: Halt in München am 28.07.2025 um 15:30 Uhr
Bei der MUT-TOUR handelt es sich um eine Tandem- und Wandertour durch ganz Deutschland, bei der Menschen mit und ohne Erfahrungen im Bereich psychischer Erkrankungen/Depressionen gemeinsam für einen offenen Umgang mit diesen werben (https://www.mut-tour.de). Start ist am 24.05.2025 in Bochum.
Unter https://www.mut-tour.de/die-mut-tour.de/die-aktuelle-mut-tour finden Interessierte die aktuellen Termine und den Streckenverlauf. Am Montag, dem 28.07.2025 um 15:30 Uhr kommen die Teilnehmer*innen in München an.
Wer Interesse hat, kann sich bei Johanna Grube, Tel.: 0151/29457782 melden. Die MUT-TOUR ist Mitglied des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit und Gewinner des DGPPN-Antistigmapreises 2015.
Datenerfassung von Menschen mit psychischen Erkrankungen als Terrorprävention weckt Ängste und stigmatisiert (Fotoverfremdung: Peter Bechmann)
Kein Zentralregister für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN) lehnt ebenso wie die Depressionsliga und andere Fachverbände und Betroffenengruppen die Register-Erfassung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ab. Diese wurde in Folge des Attentats in Magdeburg am 20. 12. 2024, bei dem ein Mann mit einem PKW in den Weihachtsmarkt raste, vom CDU-Generalsekretär Lindemann in einem Interview als Maßnahme zur Gewaltprävention gefordert.
Die DGGPN weist darauf hin, dass ein solches Register nicht zielführend wäre, sondern stigmatisierend und gefährlich. Der Anteil von psychisch erkrankten Menschen ist bei terroristischen Gewalttätern nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung.
Im Fall des Attentats von Magdeburg ist bis heute nicht geklärt, ob der Täter wirklich psychisch erkrankt ist. Die mögliche Rolle einer psychischen Erkrankung auf Basis unvollständiger Informationen zu diskutieren, ist aus Sicht der DGPPN nicht zielführend. Bei Gewalttaten ist immer im Einzelfall zu prüfen, ob eine psychische Erkrankung hierfür ursächlich war. Es gibt Faktoren, die sowohl eine Radikalisierung als auch eine psychische Erkrankung begünstigen können.
Diese Informationen sind der Pressemitteilung des DGPPN entnommen: (https://www.dgppn.de/presse/pressemitteilungen/kein-zentralregister-fuer-menschen-mit-psychischen-erkrankungen.html). Die DGPPN-Geschäftsstelle ist in der Reinhardtstraße 29, 10117 Berlin, telefonisch unter 030/2404 772-11 oder per Mail unter pressestelle@dgppn.de zu erreichen.
Headerlogo auf www.geo.de
Gut ist Nicht gut genug - Hang zur Perfektion als risiko Für die psychische Gesundheit
Wer kennt das nicht? Es ist immer Luft nach oben – und wer immer übertrieben nach Perfektion strebt, bringt seine psychische Gesundheit in Gefahr. Zum Beispiel werden chronischer Stress, Depressionen, Angststörungen und Burnout mit dem Bedürfnis, die ganze Zeit 150% zu geben und zu erreichen, in Verbindung gebracht. Menschen mit hohem Perfektionismus werten ihre eigenen Leistungen gerne ab und vergleichen sich mit anderen. Soziale Medien vermitteln eine verzerrte Vorstellung vom Erfolg, gesellschaftliche Erwartungen lassen Fehler als Makel erscheinen. Leistungsdruck: all das nagt am Selbstwert. Mit sich selbst fühlen, Selbstmitgefühl leben – eine mächtige Ressource, den eigenen Perfektionismus auf ein gesundes Maß zu reduzieren.
Im unterhaltsamen und lehrreichen Artikel „Wege aus der Perfektionismusfalle: Wie wir lernen, gnädiger mit uns selbst zu sein“ auf geo.de zeigt Solvejg Hoffmann Strategien und praktische Übungen auf, um maladaptiven, ungesunden Perfektionismus zu überwinden.
Wie freiwillig ist die Entscheidung zur Einnahme der Tablette? (Foto: Peter Bechmann)
Spektrum.de: Eine freiwillige Therapie ist nicht immer frei von Zwang
Psychisch erkrankte Menschen fühlen sich manchmal dazu gezwungen, Medikamente zu nehmen, obwohl sie diese eigentlich ablehnen könnten. Woran liegt das?
Wer psychisch krank ist und eine erhebliche Gefahr für sich oder andere darstellt, kann gegen seinen Willen in eine Psychiatrie eingewiesen und mit Beruhigungsmitteln behandelt werden. Solche Zwangsmaßnahmen greifen erkennbar in die Freiheitsrechte ein und sind deshalb lediglich in Notlagen erlaubt.
Es gibt jedoch einen Graubereich, in dem der Zwang nicht offenkundig ist und sich die Betroffenen dennoch zur Behandlung gezwungen fühlen. Wann das der Fall ist, hat eine Forschungsgruppe vom Institut für Medizinische Ethik und Geschichte von der Ruhr-Universität Bochum untersucht. In den untersuchten Fallgeschichten zeigte sich, dass verbale Überzeugungsversuche auch ohne explizit angedrohte Zwangsmaßnahmen einen psychologischen Druck erzeugen können, der einem Zwang gleichkommt: Druck durch rationale Argumente, über die emotionale Beziehungsebene, durch versprochene Vorteile oder durch angedrohte Nachteile.
Diese Informationen stammen von Spektrum.de (https://www.spektrum.de/news/eine-freiwillige-therapie-ist-nicht-immer-frei-von-zwang/2202638). Weitere Angaben zu der zitierten Studie finden dort Interessierte.
Headergrafik auf der Webseite www.psych.mpg.de
MPI für Psychiatrie: Unterschiedliche Chancen auf Psychische Gesundheit
Gene, Umwelt, Gesellschaft – es sind Faktoren, die wir nicht frei wählen können, die uns jedoch prägen und dabei auf erstaunliche Weise zusammenwirken. Traumatische Erfahrungen und die Lebensumstände steuern die Aktivität unserer Gene. Wie genetische Voraussetzungen und soziale Benachteiligung in jungen Jahren interagieren und was wir dagegen tun können, untersucht Laurel Raffington am Max-Planck-Institut (MPI) für Bildungsforschung in Berlin.
„Wir wissen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien häufiger ungünstigen Lebensbedingungen ausgesetzt sind, etwa ungesünderer Ernährung, stärkerer Luftverschmutzung oder Umweltgiften, aber auch mehr familiärem Stress“, sagt Laurel Raffington. „Sie haben ein erhöhtes Risiko für einen geringeren Bildungserfolg und eine Vielzahl von Erkrankungen“. Doch lässt sich das auch am epigenetischen Profil betroffener Kinder ablesen?
Um das herauszufinden, haben Laurel Raffington und ihr Team Speichelproben von gut 3200 Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren in den USA untersucht. Die obigen Informationen stammen von den MPIs für Bildungsforschung und für Psychiatrie (https://www.psych.mpg.de/2933065/news_publication_23959888_transferred?c=25045). Wer mehr über die Ergebnisse der Studie wissen will, der sei auf diese Website verwiesen. Kontakt ist ebenfalls über den angegebenen Link möglich.
Cover des Ausstellungskataloges “Elfriede Lohse-Wächtler: Ich als Irrwisch” erschienen im Verlag Kettler anlässlich der Hommage zum 125. Geburtstag im Ernst-Barlach-Haus in Hamburg.
„Ich als Irrwisch“: Ausstellung über die Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler in Kochel
Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See widmet der Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) eine umfassende Ausstellung, die ihr einzigartiges Werk und ihre bewegte Lebensgeschichte beleuchtet. Die Ausstellung heißt „Ich als Irrwisch“ und dauert vom 02. März bis zum 08. Juni 2025. Lohse-Wächtler gilt als eine der bedeutendsten weiblichen VertreterInnen der Kunst der Neuen Sachlichkeit, deren Werk durch Empathie und Dynamik besticht.
Bereits mit 16 Jahren verließ sie ihr Elternhaus und war ab 1918 unter dem Pseudonym „Nikolaus Wächtler“ in der Dresdner Avantgarde aktiv. Ihre kraftvollen Werke entstanden oft im Angesicht existenzieller Bedrohungen. Sie endet mit Zwangshospitalisierung und durch den NS-Staat vollzogener Ermordung: 1940 wird sie im Rahmen der nationalsozialistischen Krankenmorde (»Aktion T4«) getötet.
Diese Informationen stammen vom Franz-Marc-Museum (https://franz-marc-museum.de/ausstellung/). Weitere Angaben finden Interessierte auch unter https://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Lohse-W%C3%A4chtler.
Franz Marc Museum, Mittenwalderstraße, 82431 Kochel am See
Ein Katalog ist beim Verlag Kettler erschienen und kostet 19,50 Euro. Unter https://www.verlag-kettler.de/de/buecher/elfriede-lohse-waechtler/ zu bestellen.
Cover des Buches “Konstruktive Empörung” von Michael von Cranach erschienen im Psychiatrie-Verlag
Buchbesprechung „Konstruktive Empörung – Michael von Cranach und die Psychiatrie“
Das Buch „Konstruktive Empörung – Michael von Cranach und die Psychiatrie“ handelt von der Geschichte der Psychiatrie im Nachkriegs-Deutschland. Der größte Teil entfaltet sich im Gespräch von Michael von Cranach mit Felicitas Söhner und Thomas Becker. Söhner ist Historikerin, Becker ebenfalls Psychiater. Auch Stimmen von Betroffenen (Gottfried Wörishofer) kommen zu Wort. Dabei wird angesprochen, wie sich die deutsche Geschichte während der Nazi-Zeit auf die Psychiatrie nach 1945 ausgewirkt und wie sich die deutsche Psychiatrie im internationalen Vergleich, zum Beispiel zu Großbritannien und Italien, entwickelt hat. Dabei erfahren die Leser*innen zunächst etwas über die Biografie von Cranach, dann über sein Handeln in der Psychiatrie in Kaufbeuren und seine Meinung zu den Themen Kommunale Psychiatrie und Patienten- und Menschenrechte.
Der Name Michael von Cranach steht für die Aufarbeitung der Gräueltaten des Nationalsozialismus und die Erneuerung der Psychiatrie – daher der Titel „Konstruktive Empörung“. Das Buch ist im Psychiatrie-Verlag erschienen und kostet 35 Euro.